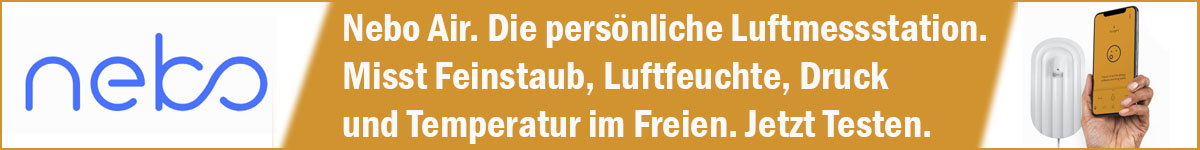Aktuelle Nachrichten zu Lufthygiene, Corona und COVID-19 aus Forschung und Wissenschaft.
„Vorsicht in Innenräumen“: Aerosol-Experte Scheuch bei Lanz im ZDF

Dr. Gerhard Scheuch gehört zu den wenigen deutschsprachigen Experten, die sich mit Aerosolen auskennen. Darum ist er derzeit ein gefragter Gesprächspartner. So auch in der ZDF-Talkshow Markus Lanz am 27. Juli 2021. Dort wiederholt er, was er schon an vielen anderen Stellen gesagt hat, sinngemäß: Aerosole übertragen Viren am besten in unbelüfteten Innenräumen. Dazu zählt er beispielsweise enge Toiletten, wie sie etwa bei Freiluftveranstaltungen aufgestellt werden, oder Aufzüge. Auch für Klassenzimmer schlägt er deshalb erneut eine Kombination aus Raumluftfiltern und Lüften vor. Masken auf dem Schulhof und dem Schulweg dagegen hält er nicht für notwendig. Bereits im Mai hat Scheuch in einem Interview ausführlich auf die Gefahr der Virusausbreitung über Aerosole in Innenräumen und die relative Ungefährlichkeit von Begegnungen im Freien hingewiesen.
Die ganze Markus-Lanz-Sendung im ZDF in der u.a. auch Gerhard Scheuch auftritt ist in der Mediathek verfügbar.
Studie zu Lüftungsarten im Vergleich
 Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat untersucht, wie Klassenzimmer am besten gelüftet werden sollten, um eine gute Luftqualität im Raum zu gewährleisten. Die Wissenschaftler verglichen dazu die Wirksamkeit von ventilatorgestützten Fensterlüftungssystemen und normalen Fensterlüften (Stoß- und Dauerlüften) mit Lüftungs- und Luftreinigungsgeräten. Anhand der Kohlendioxid- und Aerosolmessungen wurde darauf aufbauend eine Modellrechnungen für einen Unterrichtstag in einem typischen Klassenraum erstellt. Im Vergleich schnitt vor allem das klassische Fensterlüften in Kombination mit einfachen technischen Hilfsmitteln – wie z.B. Ventilatoren und Abzugshauben – besonders gut ab. Auf diese Weise konnte die Raumluftqualität hoch und die Aerosolkonzentration im Raum (und somit das potentielle Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus) möglichst gering gehalten werden. Auf Platz zwei landete der Luftaustausch mittels Luftreinigern und verwies damit die Lüftungsgeräte auf den dritten Platz.
Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat untersucht, wie Klassenzimmer am besten gelüftet werden sollten, um eine gute Luftqualität im Raum zu gewährleisten. Die Wissenschaftler verglichen dazu die Wirksamkeit von ventilatorgestützten Fensterlüftungssystemen und normalen Fensterlüften (Stoß- und Dauerlüften) mit Lüftungs- und Luftreinigungsgeräten. Anhand der Kohlendioxid- und Aerosolmessungen wurde darauf aufbauend eine Modellrechnungen für einen Unterrichtstag in einem typischen Klassenraum erstellt. Im Vergleich schnitt vor allem das klassische Fensterlüften in Kombination mit einfachen technischen Hilfsmitteln – wie z.B. Ventilatoren und Abzugshauben – besonders gut ab. Auf diese Weise konnte die Raumluftqualität hoch und die Aerosolkonzentration im Raum (und somit das potentielle Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus) möglichst gering gehalten werden. Auf Platz zwei landete der Luftaustausch mittels Luftreinigern und verwies damit die Lüftungsgeräte auf den dritten Platz.
Lüftungssystem Marke Eigenbau
Dass ein gesundes Raumklima nicht immer teuer sein muss, hat das Max-Planck-Institut bereits mit ihrer „Low-Cost-Abluftanlage“ bewiesen. Die Forscher hatten bereits Ende letzten Jahres das Fensterlüftungssystem für Klassenräume zum Selbst- bzw. Nachbau entwickelt. Das System Marke Eigenbau setzt auf eine Kombination aus Fensterlüftung und einfache technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Ventilatoren und Abzugshauben. Es stellt daher eine deutlich leichter zu realisierende, kostengünstige und trotzdem hoch wirksame Alternative zu handelsüblichen Geräten dar. Zur Bauanleitung geht es hier entlang.
Alle Ergebnisse der Studie des Max-Planck-Instituts zu den verschiedenen Lüftungsarten in Klassenzimmern finden Sie hier.
Weitere Tipps zum richtigen Lüften finden Sie zudem hier.
Neues Simulationsmodell zur Verbreitung von Aerosolen
 Aerosole gelten als die Hauptverantwortliche für die Übertragung des Corona-Virus von Mensch zu Mensch. Jedoch sind diese kleinsten Schwebeteilchen und wie sich sich genau verbreiten noch recht wenig erforscht. Das Projekt „AVATOR“ widmet sich nun genau dieser Frage. Hier forschen Wissenschaftler*innen aus 15 Fraunhofer-Instituten und -Einrichtungen in enger Zusammenarbeit. Durch die Kombination von diversen Simulationsmodellen versuchen die Forscher*innen Antworten auf die Fragen zu finden, wie sich infektiöse Aerosole in verschiedenen Räumen verteilen und wie hoch das Ansteckungsrisiko beispielsweise in Flugzeugen, Supermärkten oder Klassenzimmern ist.
Aerosole gelten als die Hauptverantwortliche für die Übertragung des Corona-Virus von Mensch zu Mensch. Jedoch sind diese kleinsten Schwebeteilchen und wie sich sich genau verbreiten noch recht wenig erforscht. Das Projekt „AVATOR“ widmet sich nun genau dieser Frage. Hier forschen Wissenschaftler*innen aus 15 Fraunhofer-Instituten und -Einrichtungen in enger Zusammenarbeit. Durch die Kombination von diversen Simulationsmodellen versuchen die Forscher*innen Antworten auf die Fragen zu finden, wie sich infektiöse Aerosole in verschiedenen Räumen verteilen und wie hoch das Ansteckungsrisiko beispielsweise in Flugzeugen, Supermärkten oder Klassenzimmern ist.
Von der Einzelsimulation zur umfassenden Simulationskette
Die Forschenden simulieren und analysieren dazu, wie sich Viren in Innenräumen ausbreiten und wie die Luft in den Innenräumen effektiv gereinigt werden kann. Neu dabei ist, dass die Wissenschaftler nicht nur auf eine einzige Simulationsmethode setzen. Sie erstellen auf Basis unterschiedlicher Verfahren und Detaillierungsgrade über lange Zeiträume hinweg viele Simulationen. Das ist nur möglich, da das Forscherteam aus vielen verschiedenen Instituten und Einrichtungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten stammt. Die Simulationen berücksichtigten das unmittelbare Nahfeld sowie das Fernfeld einer infizierten Person. Darüber hinaus befassten sich die Forschenden mit einer Untersuchung der unterschiedlichen Maskentypen und Luftströmungen, um zu erkennen wie sie sich auf die Virenlast und deren Verteilung im Raum auswirken. Auch Effekte von Bewegungen der Menschen im Raum und welche Luftströme durch diese Bewegungen ausgelöst werden, wurden untersucht.
Dieses Potpourri an Einzelsimulationen, die jedes Forscherteam in seinem jeweiligen Fachgebiet erstellt hat, wurde zu einem „Big Picture“, einer sogenannten Simulationskette, zusammengeführt. Dieses komplexe Modell macht es möglich, Aussagen zur Verbreitung von Aerosolen in konkreten Räumen zu treffen. Das Modell könnte daher eine sinnvolle Ergänzung zum situationsabhänigen R-Wert sein.
Weitere Infos zum Projekt finden Sie hier.
FFP2-Masken im Test – Welche ist die Beste?
Die Corona-Pandemie hat unser Verhalten im Alltag enorm verändert. Abstand halten, erhöhte Hygienemaßnahmen, regelmäßiges Lüften und das Tragen von Masken – kurz AHA-L – sind die neuen Maßgaben, die unseren Umgang miteinander prägen. Der Check beim Verlassen des Hauses, ob Geldbeutel, Handy, Hausschlüssel dabei sind, wurde um die FFP2-Maske erweitert. Aber was macht eine gute FFP2-Maske aus? Die Stiftung Warentest hat im aktuellen Heft genau dieses Thema unter die Lupe genommen.

Alle Masken schützen gut vor Infektionen
Im Test wurden 20 FFP2-Masken geprüft. Das erfreuliche Testergebnis lautet, dass generell alle untersuchten Masken einen hohen Schutz vor Infektionen bieten. Jedoch sei rund ein Drittel der Masken laut Test „weniger geeignet“, da man beim Tragen dieser schlechter atmen könne, weitere sieben der getesteten Masken seien aufgrund ihrer Passform nicht für jeden optimal.
Das sind die Besten
Im Test wurden FFP2-Masken aus Drogerien, Baumärkten, Apotheken, Supermärkten sowie aus dem Online- und Fachhandel für Arbeits- und Atemschutzprodukte analysiert. Die Testsieger zeichnet laut Stiftung Warentest aus, dass sie „sehr gut“ vor Aerosolen schützen, guten Atemkomfort bieten, in Passform und Dichtigkeit überzeugen und bei der Prüfung auf Schadstoffe unauffällig waren. Diese Kriterien erfüllen konkret die Maske „Aura 9320“ von 3M, die Modelle von Lindenpartner, Moldex und Uvex.
Die vollständigen Testergebnisse sowie konkrete Tipps rund um das Thema FFP2-Maske, wie zum Beispiel worauf man beim Tragen achten muss, sind hier abrufbar. Einen informativen Ratgeber zum Thema „Was Sie bei einer guten Mund-Nasen-Maske beachten müssen“ finden Sie hier.
Staubsauger gegen Aerosole
 Erst den Staub vom Boden, dann die Aerosole und Viren aus der Luft saugen. So einfach könnte die Raumhygiene der Zukunft aussehen, wenn es nach den Forschern des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geht. Sie haben nämlich einen Raumluftreiniger entwickelt, der Corona-Viren und andere Krankheitserreger in der Raumluft unschädlich macht. Der Aerobuster setzt dabei auf dieselbe Technologie wie Hepa-Filter: Die Luft wird mittels eines einfachen Metallrohrs in die Apparatur gesaugt. Im Gerät werden die Aerosole getrocknet und Viren mittels UV-C-Strahlung inaktiviert. Und das geschieht in kürzester Zeit – im schnellsten Fall in rund 0,2 Sekunden! Zudem sind die Geräte so leise, dass man neben ihnen auch problemlos arbeiten kann.
Erst den Staub vom Boden, dann die Aerosole und Viren aus der Luft saugen. So einfach könnte die Raumhygiene der Zukunft aussehen, wenn es nach den Forschern des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geht. Sie haben nämlich einen Raumluftreiniger entwickelt, der Corona-Viren und andere Krankheitserreger in der Raumluft unschädlich macht. Der Aerobuster setzt dabei auf dieselbe Technologie wie Hepa-Filter: Die Luft wird mittels eines einfachen Metallrohrs in die Apparatur gesaugt. Im Gerät werden die Aerosole getrocknet und Viren mittels UV-C-Strahlung inaktiviert. Und das geschieht in kürzester Zeit – im schnellsten Fall in rund 0,2 Sekunden! Zudem sind die Geräte so leise, dass man neben ihnen auch problemlos arbeiten kann.
Als Einsatzgebiet der Aerobuster sehen die Wissenschaftler Klassenzimmer und alle anderen Orte mit viel Publikumsverkehr wie Krankenhäuser, Pflege- und Altenheimen, Werkshallen, öffentliche Verkehrsmittel oder auch Wartebereiche. Das Forschungsinstitut hat in Kooperation mit einem Partnerunternehmen bereits mit der Produktion der Aerobuster für den Markt begonnen. Ein finaler Anschaffungspreis steht noch nicht fest, wird aber, nach Aussage der Forscher, bei unter 1.000 Euro pro Geräte liegen.
Mehr zum Aerobuster finden Sie hier.
Lüften oder Luftfilter?
 Ein Schutz von Schüler*innen vor dem Corona-Virus per Impfung ist bis zum Ende der Sommerferien unrealistisch. Die STIKO empfiehlt eine Impfung für die Gruppe der 12- bis 18-Jährigen lediglich in Ausnahmefällen. Für jüngere Kinder ist sogar noch gar kein Impfstoff zugelassen. Daher stellt sich für viele die Frage, wie es im Herbst in den Schulen weiter geht: Reichen Abstand halten, Maske tragen und die Fenster regelmäßig zum Lüften zu öffnen aus oder ist der Einsatz von unterstützender Technik, wie zum Beispiel Raumluftfilter, nötig?
Ein Schutz von Schüler*innen vor dem Corona-Virus per Impfung ist bis zum Ende der Sommerferien unrealistisch. Die STIKO empfiehlt eine Impfung für die Gruppe der 12- bis 18-Jährigen lediglich in Ausnahmefällen. Für jüngere Kinder ist sogar noch gar kein Impfstoff zugelassen. Daher stellt sich für viele die Frage, wie es im Herbst in den Schulen weiter geht: Reichen Abstand halten, Maske tragen und die Fenster regelmäßig zum Lüften zu öffnen aus oder ist der Einsatz von unterstützender Technik, wie zum Beispiel Raumluftfilter, nötig?
Die Universität Stuttgart hat im Auftrag der baden-württembergischen Landeshauptstadt für ein halbes Jahr an zehn Stuttgarter Schulen Untersuchungen durchgeführt. Ein spezielles Augenmerk wurde auf den Effekt von mobilen und stationären Geräten zur Luftreinigung und deren Effekt auf die Raumluftqualität im Klassenzimmer.
Die Kombi macht’s
Die Untersuchungen ergaben, dass regelmäßiges Stoßlüften das beste Mittel und auch billigste ist, um die Aerosolkonzentration in den untersuchten Klassenzimmern niedrig zu halten. Der alleinige Einsatz von mobilen oder stationären Luftfiltern könne – so die Forscher – nicht das regelmäßige Lüften ersetzen. Das Raumluft-Management im Klassenzimmer sollte also sowohl auf Raumlüfter als auch auf das Stoßlüften setzen.
Die Empfehlungen der Forscher auf Basis der Studienerkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Das Tragen von Masken im Unterricht schützt die Kinder unmittelbar vor Infektionen.
- Regelmäßiges Stoßlüften in den Pausen ist Pflicht, da eine Dauerkipplüftung nur wenig beim Verringern der Aerosolkonzentration unterstützt. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tipps zum richtigen Lüften ist hier abrufbar.
- Luftreinigungsgeräte sind eine tolle Ergänzung zum Stoßlüften (eine Übersicht über aktuelle Modelle finden Sie hier).
- Die untersuchten Luftreinigungsgeräte stören leider den Unterricht, da sie zu laut sind.
- Der Einbau von langfristigen, dauerhaften Lösungen, wie RLT-Anlagen, wird empfohlen.
Die vollständige Studie ist hier abrufbar.
Drei Faktoren erhöhen das Risiko, dass man zum Superspreader wird
 Der Hauptübertragungsweg des Corona-Virus von Mensch zu Mensch ist bekannterweise jener über Aerosole. Die Viren nutzen dabei diese kleinsten Schwebeteilchen, die von Menschen mit jedem Atemzug ein- und ausgeatmet werden, um sich zu verbreiten. Bisher war es jedoch ein Mysterium, warum manche Menschen infektiöser sind als andere. Denn laut aktuellem Forschungsstand sind nur eine kleiner Anteil aller mit dem Covid-19-Virus Infizierten – die sogenannten Superspreader – für einen Großteil der Ansteckungen verantwortlich.
Der Hauptübertragungsweg des Corona-Virus von Mensch zu Mensch ist bekannterweise jener über Aerosole. Die Viren nutzen dabei diese kleinsten Schwebeteilchen, die von Menschen mit jedem Atemzug ein- und ausgeatmet werden, um sich zu verbreiten. Bisher war es jedoch ein Mysterium, warum manche Menschen infektiöser sind als andere. Denn laut aktuellem Forschungsstand sind nur eine kleiner Anteil aller mit dem Covid-19-Virus Infizierten – die sogenannten Superspreader – für einen Großteil der Ansteckungen verantwortlich.
Superspreader: Knapp ein Fünftel der Probanden produzieren 80 Prozent der Aerosole
Ein Team aus Forschern der Universität Harvard haben diese Personengruppe nun genauer unter die Lupe genommen. Dazu haben sie Probanden zwischen 19 und 66 Jahren, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert waren, untersucht. Mit zugehaltener Nase atmeten die Studienteilnehmer in das Mundstück eines Detektors. So wurden die ausgestoßenen Partikel aufgefangen und analysiert. Dabei kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass lediglich 18 Prozent der Untersuchten für sage und schreibe 80 Prozent der gesamten ausgestoßenen Aerosole gesorgt haben. Zudem haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass im wesentlichen drei Faktoren dazu führen, dass man als Superspreader in Frage kommt:
- Alter
- Ernährungsgewohnheiten
- Lungeninfektionen
Zusammenhang Alter und BMI
Die Forscher der Harvard University konnten in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Gewicht herstellen: Personen unter 26 Jahren mit einem geringen Body-Mass-Index (BMI) gelten daher als sogenannte „Low Spreader“, die nur wenige Aerosole ausgestoßen haben. Ältere Menschen mit höherem BMI hingegen würden – so die Forscher weiter – mehr Aerosole ausstoßen. Im Rahmen der Studie konnte so ein klarer Zusammenhang zwischen dem Alter und Gewicht hergestellt werden: Je älter und höher der BMI der untersuchten Person, desto höher der Aerosolausstoß. Als dritten Faktor, der eine erhöhte Aerosol-Produktion begünstigt, haben die Forscher Atemwegsvorerkrankungen identifiziert.
Der vollständige Forschungsbericht wurde im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.
Plädoyer für den Einsatz von Luftfilter-Anlagen in Schulen
Luftfilter-Anlagen gelten als Mittel der Wahl, um Klassenzimmer auch in Pandemie-Zeiten für Schüler möglichst sicher zu gestalten. Denn oftmals sind Klassenzimmer so aufgebaut und besetzt, dass ein reines Stoßlüften alle 20 Minuten nicht ausreicht, um die Aerosolkonzentration niedrig zu halten. Um die Schulen für eine vierte Welle der Corona-Pandemie im Herbst zu wappnen, hat beispielsweise die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg den Kommunen für die Anschaffung von Luftfilter-Anlagen rund 60 Millionen Euro an Fördergeldern in Aussicht gestellt. So weit so gut. Aber ist es überhaupt noch realistisch, dass bis zum Start des neuen Schuljahres im September alle Schulen eine entsprechende Anzahl an Luftfilter-Anlagen erhalten und installieren können? Sind sie das neue Toilettenpapier, also das knappe Gut? Im aktuellen Podcast erklärt Andreas Heller vom SWR, warum Luftfilter-Anlagen zum Schutz vor dem Coronavirus in Klassenzimmern notwendig sind, und er lässt auch einen Hersteller von Luftfilter-Anlagen mit dessen Sicht der Dinge zu Wort kommen.
Eine Zusammenfassung des Podcasts ist hier abrufbar.
Virtuelle Reise durchs Corona-Virus
 Das ZDF hat eine informative 3D-Animation zum Corona-Virus erstellt:
Das ZDF hat eine informative 3D-Animation zum Corona-Virus erstellt:
Bequem vom Schreibtisch aus kann man einen Blick ins Innere des Sars-Cov-2-Virus werfen und lernt zeitgleich viel über dessen Aufbau. Besonders interessant ist dabei die Gegenüberstellung, was wir im letzten Jahr über das Virus gelernt haben.
Zur spannenden und aufschlussreichen Reise durch das Virus geht es hier entlang: https://3d.zdf.de/corona-mutation/
FFP2-Masken mit integriertem Corona-Test
Aktuell gilt im Alltag noch eine Pflicht zum Tragen von FFP2- bzw. medizinischen Masken, wenn das Einhalten der AHA-L-Regeln nicht gewährleistet werden kann, wie beispielsweise in Menschenmassen aber auch in geschlossenen Räumen. Das Risiko, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, gilt in diesen Situationen als erhöht. Das Tragen von Masken soll uns vor einer Infektion schützen, falls eine der anwesenden Personen mit dem Corona-Virus infiziert ist.
Neues Feature für FFP2-Masken und Kleidung
Forscher der US-Eliteuniversitäten MIT und Harvard haben nun spezielle Biosensoren entwickelt, die Corona-Viren erkennen können. Die Sensoren lassen sich beispielsweise in Kleidungsstücke aber auch FFP2-Masken integrieren und können so die Träger vor Corona-Viren in der Luft warnen. Wird das Virus gefunden, verfärbt sich der Stoff. Die Sensoren ähneln jenen, die bereits bei Antigenschnelltests genutzt werden. Sie sind – laut der Forscher – auch relativ einfach auf andere Viren, wie zum Beispiel Zika oder Ebola, adaptierbar.
Laborkittel warnen vor Viren in der Luft
 Die Biosensoren eignen sich auch für Spezialkleidung in Krankenhäusern: Die Berufskleidung von Krankenpflegern kann dann als eine Art „Frühwarnsystem“ zur Erkennung von Krankheitserregern in der Raumluft genutzt werden. Tritt der Virus, auf den die Biosensoren testen, in der Krankenhausluft auf, springt das Frühwarnsystem an.
Die Biosensoren eignen sich auch für Spezialkleidung in Krankenhäusern: Die Berufskleidung von Krankenpflegern kann dann als eine Art „Frühwarnsystem“ zur Erkennung von Krankheitserregern in der Raumluft genutzt werden. Tritt der Virus, auf den die Biosensoren testen, in der Krankenhausluft auf, springt das Frühwarnsystem an.
Corona-Schnelltest per Maske
Eine von den Forschern entwickelte FFP2-Maske ermöglicht einen Corona-Selbsttest. Die Biosensoren sind dabei auf der Innenseite der Papiermaske und werden per Knopfdruck aktiviert. Der Sensor sammelt dann gegebenenfalls vorhandene Viruspartikel im Atem des Maskenträgers. Nach nur 90 Sekunden liegt das Testergebnis vor, das – laut Aussagen der Forscher – genauso zuverlässig, wie ein PCR-Test sei, nur eben um einiges schneller.
Alls Infos zur Studie sind hier abrufbar.
Illustration: Andrey Popov @ AdobeStock . com