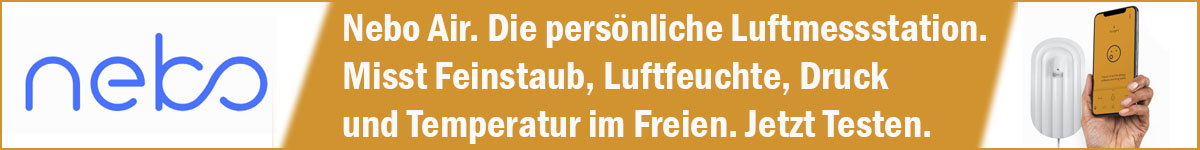Aktuelle Nachrichten zu Lufthygiene, Corona und COVID-19 aus Forschung und Wissenschaft.
WHO: Neue Leitlinien zur Luftqualität
 Die Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) hat nach 15 Jahren im September neue Leitlinien zur Luftqualität veröffentlicht. In diesen rät sie zu strengeren Vorgaben, um die Luftverschmutzung zu senken und unsere Gesundheit besser zu schützen. Denn auch in niedriger Konzentrationen seien Schadstoffe in der Luft oft bereits gesundheitsgefährdend.
Die Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) hat nach 15 Jahren im September neue Leitlinien zur Luftqualität veröffentlicht. In diesen rät sie zu strengeren Vorgaben, um die Luftverschmutzung zu senken und unsere Gesundheit besser zu schützen. Denn auch in niedriger Konzentrationen seien Schadstoffe in der Luft oft bereits gesundheitsgefährdend.
Verschärfung der Grenzwerte
In Deutschland sind die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Konzentrationen die Sorgenkinder. Die erlaubten Grenzwerte für die Konzentration dieser Stoffe in der Luft wurde auch in den neuen Leitlinien nochmals deutlich verschärft: Die WHO empfiehlt nun einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft für Stickstoffdioxid (bisher 40 Mikrogramm). Beim Feinstaub wurde der Grenzwert für kleine Partikel (PM 2,5) auf höchsten fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft halbiert (bisher 10 Mikrogramm), für größere Partikel (PM10) wird ein Grenzwert von 15 (statt bisher 20) Mikrogramm empfohlen.
Die Leitlinien der WHO sind nicht gesetzlich bindend, der Gesetzgeber bzw. die EU haben das letzte Wort, inwiefern diese angepasst bzw. umgesetzt werden.
Alle Infos zu den neuen Leitlinien der WHO sind hier abrufbar.
Schützt eine Grippe-Impfung auch vor einem schwerem Corona-Verlauf?
 Die Grippe-Saison steht bereits vor der Tür und damit auch die Gretchen-Frage Impfung ja oder nein. Fiel im Corona-Winter 2020 die Grippewelle aufgrund der AHA-Regeln und Social Distancing nahezu aus, prognostizieren Experten für den kommenden Herbst und Winter eine Explosion der Influenza-Infektionen und raten zum Gang zum Impfarzt. Denn das Immunsystem sei durch die Corona-Schutzmaßnahmen komplett außer Training und daher für Infektionskrankheiten anfälliger. Zudem werden Hygienemaßnahmen, wie Maskenpflicht und Abstandsregeln, passend zum Start der Erkältungszeit zurückgefahren.
Die Grippe-Saison steht bereits vor der Tür und damit auch die Gretchen-Frage Impfung ja oder nein. Fiel im Corona-Winter 2020 die Grippewelle aufgrund der AHA-Regeln und Social Distancing nahezu aus, prognostizieren Experten für den kommenden Herbst und Winter eine Explosion der Influenza-Infektionen und raten zum Gang zum Impfarzt. Denn das Immunsystem sei durch die Corona-Schutzmaßnahmen komplett außer Training und daher für Infektionskrankheiten anfälliger. Zudem werden Hygienemaßnahmen, wie Maskenpflicht und Abstandsregeln, passend zum Start der Erkältungszeit zurückgefahren.
Doppelter Schutz mit einem Piks?
Forschende der „Miller School of Medicine“ der University of Miami haben einen interessanten Nebeneffekt der Grippe-Impfung entdeckt. Laut der Wissenschaftler schütze sie sehr wahrscheinlich auch vor einem schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion. Eine jährliche Grippe-Impfung senke das Risiko von schweren Komplikationen – wie z.B. das Erleiden eines Schlaganfalls, einer Sepsis oder Thrombose – bei einer Corona-Infektion signifikant. Das Risiko, während einer Corona-Infektion auf intensivmedizinische Behandlungen angewiesen zu sein, liege bei ungeimpften Patienten um 20 Prozent höher als bei Patienten mit Grippeschutz-Impfung. Notfallmedizinische Behandlungen wurden bei Patienten ohne Impfschutz sogar um 58 Prozent häufiger notwendig. Die groß angelegte Studie basiert auf Daten von fast 750 000 Patientinnen und Patienten aus unterschiedlichen Ländern.
Die Original-Meldung zur Studie ist hier abrufbar, die Ergebnisse wurden zudem im Fachmagazin PLoS One veröffentlicht.
Raumluftklima in vielen Büros nur „befriedigend“
 Ob zu Hause, bei der Arbeit, beim Einkaufen oder in Verkehrsmitteln: zwischen 80 und 90 Prozent unseres Alltags verbringen wir in geschlossenen Räumen. Das sind mehr als 20 Stunden pro Tag. Umso verwunderlicher ist es, dass ein gutes und gesundes Raumklima erst in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt ins Bewusstsein gerückt ist. Eine saubere Raumluft schützt jedoch nicht nur vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Sie senkt das Infektionsrisiko mit nahezu allen Viruserkrankungen, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und kann die Produktivität am Arbeitsplatz steigern.
Ob zu Hause, bei der Arbeit, beim Einkaufen oder in Verkehrsmitteln: zwischen 80 und 90 Prozent unseres Alltags verbringen wir in geschlossenen Räumen. Das sind mehr als 20 Stunden pro Tag. Umso verwunderlicher ist es, dass ein gutes und gesundes Raumklima erst in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt ins Bewusstsein gerückt ist. Eine saubere Raumluft schützt jedoch nicht nur vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Sie senkt das Infektionsrisiko mit nahezu allen Viruserkrankungen, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und kann die Produktivität am Arbeitsplatz steigern.
Raumklima im Schnitt nur „befriedigend“ – Luft nach oben
Das Büro-Magazin Office Roxx hat in einer aktuellen Leserbefragung im Auftrag der Initiative PrimaBüroKlima evaluiert, wie es um die Raumluft im Büro der Leser bestellt ist. Mit einer Schulnote von durchschnittlich 3,1 – also lediglich „befriedigend“ – bewerteten die 512 Teilnehmer das Raumklima an ihrem Arbeitsplatz. Nur sieben Prozent stufen das vorherrschende Raumklima als „sehr gut“ ein, elf Prozent vergaben sogar die Schulnoten 5 und 6. Nach über eineinhalb Pandemie-Jahren und immer mehr Arbeitnehmern, die wieder in den Büros präsent sind, stimmen diese Werte nachdenklich. Zudem bewerten rund 44 Prozent der Umfrageteilnehmer – also fast die Hälfte – das Risiko, sich mit dem Corona-Virus im Büro anzustecken, als „hoch“ bis „sehr hoch“. Nur ein Viertel der Befragten fühlt sich am Arbeitsplatz sicher und schätzt das Infektionsrisiko als „gering“ ein.
Probleme: Temperatur, Zugluft, Luftfeuchte und zu wenig frische Luft
Wirft man einen Blick auf die raumklimatischen Faktoren, die am jeweiligen Arbeitsplatz als störend oder problematisch eingestuft werden, steht die Raumtemperatur an erster Stelle (30 Prozent). Über die Luftgeschwindigkeit, also dass es „zieht“, beklagen sich 20 Prozent der Befragten. Die Themen Luftfeuchte zu wenig frische Luft folgen auf den weiteren Plätzen.
Fensterlüftung nach wie vor dominierend
In vier von fünf Büros wird die Frischluftzufuhr durch regelmäßiges Öffnen der Fenster geregelt (78 Prozent), lediglich 16 Prozent der Büros verfügen über eine Klimaanlage. Luftreiniger kommen bei lediglich zwölf Prozent der Befragten zum Einsatz. I
Die vollständigen Ergebnisse der Leserbefragung sind hier abrufbar.
Informative Übersicht zum Thema Aerosole
 Über viele Jahre hinweg galt in der Medizin die sogenannte Tröpfcheninfektion als der hauptsächliche Übertragungsweg aller respiratorischen Viren. Das SARS-CoV-2-Virus und die dadurch ausgelöste weltweite Pandemie haben uns eines Besseren belehrt: Nicht Tröpfchen sind die Übeltäter, sondern mikroskopisch kleinen Aerosole. Die Übertragung von Viren durch infektiöse Aerosole in der Atemluft hat zur raschen Ausbreitung des Corona-Virus im Frühjahr 2020 geführt. Mediziner gehen zudem davon aus, dass auch andere Viren, die zu Atemwegserkrankungen führen, ihren Weg von Mensch zu Mensch über das Transportmittel Aerosole bestreiten.
Über viele Jahre hinweg galt in der Medizin die sogenannte Tröpfcheninfektion als der hauptsächliche Übertragungsweg aller respiratorischen Viren. Das SARS-CoV-2-Virus und die dadurch ausgelöste weltweite Pandemie haben uns eines Besseren belehrt: Nicht Tröpfchen sind die Übeltäter, sondern mikroskopisch kleinen Aerosole. Die Übertragung von Viren durch infektiöse Aerosole in der Atemluft hat zur raschen Ausbreitung des Corona-Virus im Frühjahr 2020 geführt. Mediziner gehen zudem davon aus, dass auch andere Viren, die zu Atemwegserkrankungen führen, ihren Weg von Mensch zu Mensch über das Transportmittel Aerosole bestreiten.
Übersicht zum Status Quo der Aerosol-Forschung
Aerosole als Übertragungsweg von Viren sind erst seit der Corona-Pandemie in den Fokus der Öffentlichkeit und Forschung gerückt. In einem aktuellen Review veröffentlicht das renommierte Fachmagazin Science nun den aktuellen Stand der Forschung zu Aerosolen. Die Forscher tragen darin unter anderem zusammen, wie sich Aerosole von Tröpfchen unterscheiden, wo im Körper Aerosole produziert werden oder wie ihre Übertragung von Mensch zu Mensch vonstatten geht.
Vier Faktoren machen Viren in der Luft unschädlich
Wie mehrere wissenschaftliche Studien belegen, herrscht die größte Ansteckungsgefahr durch infektiöse Aerosole in Innenräumen (vgl. z.B. die Studie des Herrmann-Rietschel-Instituts zum situationsbezogenen R-Wert). Die Forscher identifizieren daher vier Faktoren, die das Überleben des Corona-Virus in den Aerosolen beeinflussen:
-
- Temperatur: Hier gilt die Faustregel „je kühler desto besser für das Virus“, was auch den saisonalen Effekt der Corona-Infektionen mit erklärt.
- Relative Feuchte: Eine Studie der RWTH Aachen gibt z.B. eine Luftfeuchte von 40 bis 60 Prozent als idealen Wert an, da eine hohe Luftfeuchte sowohl Viren als auch Aerosole deaktiviere.
- UV-Strahlung schädigt ebenfalls Aerosole und das genetische Material der Viren.
- Luftzirkulation, Belüftung und Luftfilter – eine interessante Übersicht zu verschiedenen Luftfiltermodellen finden Sie hier, nützliche Tipps zum richtigen Lüften gibt es hier.
Eine Zusammenfassung des Science-Reviews finden Sie hier.
Terminhinweis: Branchentreff „Indoor-Air“ vom 5. bis 10. Oktober in Frankfurt

Kaum eine Branche stand im letzten Jahr so im Fokus, wie die Klima- und Lüftungsindustrie. Gelten doch eine gute, saubere Raumluft und ein funktionierendes Lüftungskonzept als wichtige Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Daher liegt es auch Nahe, dass sich die Branche nun zum ersten Mal zu einer Leistungsschau trifft: Vom 5. bis 10. Oktober 2021 präsentieren Experten der Klima- und Lüftungsindustrie aus dem deutschsprachigen Raum auf der Indoor-Air in Frankfurt am Main ihre Produkte und Innovationen für saubere Luft in Innenräumen. Rund 80 Aussteller werden laut Messeveranstalter ihre Lösungen vor Ort dem Fachpublikum vorstellen. Ein hochkarätiges Vortragsprogramm an allen drei Messetagen rundet die Präsenzveranstaltung ab.
Selbstverständlich wird die Indoor-Air unter Einhaltung eines detaillierten Schutz- und Hygienekonzepts (z.B. 3G-Prinzip) veranstaltet.
Weitere Informationen zur Indoor-Air inkl. einer Ausstellerliste und Ticket-Shop finden Sie hier:
Studie: Grundschulkinder verbreiten weniger Aerosole als Erwachsene
 Laut einer aktuellen Studie der Berliner Charité und der Technischen Universität Berlin stoßen Kinder im Grundschulalter wesentlich weniger Aerosole beim Atmen, Singen oder Sprechen in Innenräumen aus als Erwachsene. Da die Emissionsrate, also die Menge der ausgeschiedenen Aerosolpartikel in der Luft, stark nach Altersgruppe variiere, regen die Forscher an, das Risikomanagement im Umfeld von Schulen neu zu diskutieren. Denn bisher beruhte die Gefährdungsbeurteilung auf Aerosolpartikelkonzentrations-Werten von Erwachsenen, die sich nach den aktuellen Erkenntnissen stark von jenen der Kinder unterscheiden.
Laut einer aktuellen Studie der Berliner Charité und der Technischen Universität Berlin stoßen Kinder im Grundschulalter wesentlich weniger Aerosole beim Atmen, Singen oder Sprechen in Innenräumen aus als Erwachsene. Da die Emissionsrate, also die Menge der ausgeschiedenen Aerosolpartikel in der Luft, stark nach Altersgruppe variiere, regen die Forscher an, das Risikomanagement im Umfeld von Schulen neu zu diskutieren. Denn bisher beruhte die Gefährdungsbeurteilung auf Aerosolpartikelkonzentrations-Werten von Erwachsenen, die sich nach den aktuellen Erkenntnissen stark von jenen der Kinder unterscheiden.
Kleine Studie mit überraschenden Ergebnissen
Im Rahmen der sogenannten kleinen Studie untersuchten die Berliner Wissenschaftler die Aerosolemission von 15 Kindern zwischen 8 und 10 Jahren. Die Kids waren dabei in einem Reinraum in Schutzanzügen und sangen, atmeten, sprachen oder riefen in die Öffnung eines Glasrohres mit eingebauten Laserpartikel-Zähler. 15 Erwachsene im Alter von 23 bis 64 Jahren wurden unter denselben Bedingungen als Vergleichsgruppe analysiert. Sowohl bei der Ruheatmung als auch beim Sprechen oder Singen wurden bei den Grundschülern durchweg signifikant geringere Emissionsraten gemessen als bei den Erwachsenen. Lediglich beim Rufen zeigten sich keine großen Unterschiede.
Über die Studie berichtete unter anderem der Stern.
Hör mal zu: Der Südwestrundfunk über die Ansteckung durch Aerosole

Bild von Alexandra Koch via Pixabay
Der Sender SWR2 erklärt in einem rund 3 Minuten langen Hörbeitrag die Ansteckungsgefahr durch Aerosol-Partikel in Innenräumen.
Für Forscher und Wissenschaftler sind diese Kleinst-Partikel das eigentliche Problem der Corona-Pandemie.
Erkenntnisse und Ergebnisse von Forschungen bringt der Live-Blog des SWR in diesem hörenswerten Beitrag.
Einfach gut: Die Corona-Test-Anleitung der Augsburger Puppenkiste

Ohne viele Worte, aber gut erklärt: das Erklär-Video der Augsburger Puppenkiste: So funktioniert der Corona-Selbst-text, jedenfalls an bayerischen Schulen. Das Anschauen lohnt aber nicht nur für Kinder und nicht nur für Bayern:
Sechs Universitätskliniken forschen zu „Long Covid“
 Wie der Sender Antenne Düsseldorf online meldet, forschen die sechs Universitätskliniken Düsseldorf, Aachen, Bonn, Essen, Köln und Münster gemeinsam unter dem Projektnamen „Beyond COVID 19“ zu den Langzeit-Auswirkungen von Covid-19 – auch bekannt unter „Long Covid“.
Wie der Sender Antenne Düsseldorf online meldet, forschen die sechs Universitätskliniken Düsseldorf, Aachen, Bonn, Essen, Köln und Münster gemeinsam unter dem Projektnamen „Beyond COVID 19“ zu den Langzeit-Auswirkungen von Covid-19 – auch bekannt unter „Long Covid“.
Im Rahmen des neuen Forschungsprojektes, das jüngst unter der Leitung und in der Uniklinik Düsseldorf an den Start ging, werden unterschiedliche Gruppen von Covid-Patienten und Patientinnen in regelmäßigen Abständen untersucht und befragt.
Dadurch soll laut Meldung „…ein klareres Bild entstehen, was genau für Langzeitfolgen eine Corona-Erkrankung haben kann, wie häufig sie vorkommen und wie man sie therapieren kann…“.
Zur vollständigen Meldung geht es > hier entlang <
Neue Studie: Corona-Impfung schützt auch vor Long-COVID
 Einer aktuellen britischen Studie zufolge schützt eine COVID-19-Impfung nicht nur vor schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung, sondern auch gut gegen Long-COVID, also gegen die gefürchteten Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion.
Einer aktuellen britischen Studie zufolge schützt eine COVID-19-Impfung nicht nur vor schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung, sondern auch gut gegen Long-COVID, also gegen die gefürchteten Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion.
Der Anteil von Patienten, bei denen es zu Langzeitfolgen kam, lag demnach bei geimpften Erkrankten bei nur 50% gegenüber nicht geimpften Patienten.
Insgesamt wurden die Daten von 1,24 Millionen Nutzer einer Corona-App ausgewertet. Nach eigenen Angaben gab es ca. 6.000 Personen, die sich nach einer Erstimpfung infizierten und rund 2.300 Personen, die sich nach einer Zweitimpfung mit dem Virus ansteckten. Die Schwere der Erkrankung war im Schnitt deutlich geringer, als bei nicht geimpften Erkrankten. Dies gilt insbesondere für ältere Personen. Der Anteil von Personen, die 28 Tage nach einem positiven PCR-Test noch unter Symptomen litten, lag um rund 50 Prozent unterhalb demjenigen bei Nichtgeimpften. Auch hier erwies sich die Impfung bei älteren Probanten als besonders wirkungsvoll.
Quelle: The Lancet
Illustration: Andrey Popov @ AdobeStock . com