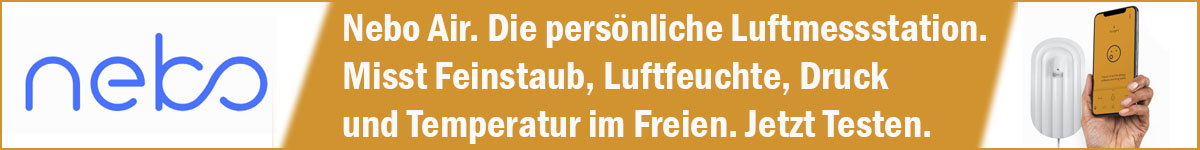Aktuelle Nachrichten zu Lufthygiene, Corona und COVID-19 aus Forschung und Wissenschaft.
1,3 % aller Kinder in den USA waren an Long COVID erkrankt
Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie des „National Center for Health Statistics“ berichtet, dass rund 1,3 Prozent aller Kinder in den USA bis zum Jahr 2022 irgendwann von Long COVID betroffen waren. dabei waren deutlich mehr Mädchen (1,6%) als Jungen (0,9%) betroffen. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren waren wiederum stärker beroffen, als Kinder uner 11 Jahren.
Kinder galten als lang an COVID erkrankt, wenn ihre Eltern ein PCR-Testergebnis für eine SARS-CoV-2-Infektion meldeten, wenn neue Symptome innerhalb von drei Monaten nach einem positiven PCR-Ergebnis für COVID-19 auftraten und wenn diese Symptome mindestens acht Wochen oder vier Berichtszeiträume lang anhielten.
Zu den häufigsten Symptomen gehörten Schnupfen (62%), Hlasschmerzen (68%),, Kopfschmerzen (52%), Husten (42%), Fieber (41%) und Müdigkeit (35%). Quelle: https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db479.htm.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Corona-Booster im Herbst 2023?
Studie: Corona für Übersterblichkeit in Deutschland verantwortlich
Dass die Übersterblichkeit, die in den Pandemie-Jahren auch für Deutschland nachgewiesen ist, auf Coronoa zurückzuführen ist, scheint eine neue Studie auf der Grundlage von umfangreichen Krankenkassendaten zu belegen. Mehr als drei viertel der Übersterblichkeit war der Studie des BARMER Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) zufolge mit vorangegangenen Covid-19-Diagnosen verbunden. Der Studie zufolge sind in den Pandemiejahren von 2020 bis 2022 etwa 166.000 mehr Menschen gestorben, als zu erwarten gewesen wäre. Diese Übersterblichkeit entfiel demnach fast vollständig auf Menschen, die 60 Jahre oder älter waren. Quelle: tagesschau faktenfinder.
Klimakontrolle in der Elektrobranche
Eine gesunde Raumluft und ein ausgeglichenes Raumklima sind essentiell für unsere Gesundheit, aber dass das Raumklima auch Auswirkungen auf die Produktion und Fertigung von Bauteilen der Elektrobranche hat, ist nur wenigen bekannt.
Aus diesem Grund gibt es Normen und Richtlinien, an die sich die Unternehmen halten sollen, wenn sie sensible Bauteile herstellen.
Welche Probleme können auftreten?
Kleiner, schneller und smarter: über ein Viertel des Elektromarktes fällt heute auf den Bereich der elektronischen Bauelemente und Halbleiter, die immer kleiner und leistungsfähiger werden.
Mit zunehmender Miniaturisierung und Automation steigt aber die Anfälligkeit für Störungen im Fertigungsprozess: Fehlfunktionen oder eine verkürzte Lebensdauer von Halbleitern können
nur durch eine umfassende Qualitätssicherung ausgeschlossen werden. Die Temperatur und besonders die relative Luftfeuchte sind wichtige Parameter einer standardisierten Produktion, die einen großen
Einfluss auf die geforderte Qualität der Produkte haben.
Problem Elektrostatik
Der Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD) ist eines der grundlegenden Gebote für nahezu jedes
Unternehmen der Elektronikindustrie. 25 Prozent aller identifizierten Fehlfunktionen sollen nach Aussage führender Hersteller auf Elektrostatik zurückzuführen sein. Ein wesentlicher Baustein in jedem ESD-Schutzprogramm ist die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Denn sie wirkt sich unmittelbar auf das Ableitverhalten von Materialien und Bauteilen aus: Ist die Luft beispielsweise zu trocken, steigt die Aufladungsneigung stark an.
Qualitätssicherung
Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Viskosität der Lötpaste und kann dadurch die Stabilität des Lötprozesses beeinträchtigen. Bei Klebe-, Verguss- und Lackierprozessen führt eine nicht ausreichende Luftfeuchte zu Haftungsproblemen. Elektrische Prüfungen und Funktionstests
können bei schwankenden Luftfeuchtewerten keine zuverlässigen Ergebnisse liefern.
Mitarbeitergesundheit
Ein optimales Raumklima schützt die Mitarbeiter vor Erkrankungen der Atemwege, ausgetrockneten Schleimhäuten, trockenen Augen und weiteren Beschwerden.
Mehr zu diesem Thema gibt es in diesem ausführlichen Whitepaper von Condair Systems, erschienen auf ElektonikPraxis.de: Whitepaper Condair / ElektronikPraxis

Foto von Anne Nygård auf Unsplash
Super-Pflanze „Neo P1“ reinigt Raumluft 30-mal effektiver
Ein französisches Forscherteam, das für das Start-up Unternehmen „Neoplants“ arbeitet, hat eine Pflanze mit echten Superkräften entwickelt. Neo P1 kann nämlich unter anderem gefährliche und krebserregende Schadstoffe aus der Raumluft filtern und ist in Sachen Raumluftreinigung 30-mal effektiver als eine herkömmliche luftreinigende Pflanze.
Neo P1 ist eine biotechnologisch weiterentwickelte Form von Pothos, der allseits beliebten Efeutute. Wie das Einblatt oder die Grünlilie zählt Pothos zu den Zimmerpflanzen, die unsere Raumluft reinigen können.
Nach Angaben des 20-köpfigen Forscherteams soll Neo P1 Schadstoffe wie beispielsweise Benzol, Formaldehyd, Toluol und Xyole beseitigen. Diese Stoffe stehen im Verdacht, Herz- und Lungenkrankheiten, im schlimmsten Fall sogar Krebs zu verursachen.
Wo es Neo P1 zu kaufen gibt, welche Pflege sie benötigt und viele weitere interessante Fakten zur Super-Pflanze finden Sie hier:
- Neo P1: Alles Wissenswerte über die Superpflanze (fuersie.de)
- „Super-Pflanze“ reinigt Raumluft 30 Mal effektiver – myHOMEBOOK
- Neoplants – Product

Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Energetische Sanierung: Wohnraumlüftung kann einfach nachgerüstet werden
Steigenden Energiekosten zu entkommen, funktioniert prima mit einer energetischen Sanierung des Eigenheims. Hierbei lässt sich der Energieverbrauch für Heizung, Warmwasseraufbereitung und Lüftung minimieren. Das entlastet nicht nur den Geldbeutel, sondern die Sanierung kommt auch der Umwelt zu Gute, denn der CO2-Ausstoß wird deutlich reduziert.
Doch Vorsicht ist geboten!
Durch die luftdichte Bauweise und Dämmung bleibt zwar die Wärme im Haus, die Luftfeuchtigkeit kann jedoch nicht mehr über kleine Undichtigkeiten entweichen. In dichten Gebäuden müsste deshalb alle zwei Stunden stoßgelüftet werden, um eine gesunde Raumluft zu gewährleisten und Schimmelschäden zu vermeiden. Das wiederum ist im Alltag kaum zu schaffen und bei unsachgemäßem Lüftungsverhalten weicht ein Großteil der Wärme wieder nach draußen ab. Deshalb ist laut der in Deutschland gültigen Baurichtlinie DIN 1946-6 bei Sanierungen ein Lüftungskonzept gefordert, wenn mehr als ein Drittel der Fenster bei der Sanierung getauscht werden oder mehr als ein Drittel der Dachfläche abgedichtet wird. Hier kann ein Energieberater helfen und ermitteln, ob die Luftströme im Haus ausreichend sind, oder ob ein Lüftungssystem nachgerüstet werden muss.
Welche Lüftungssysteme hilfreich sind und wie sie sich einfach nachrüsten lassen, finden Sie hier: Energetische Sanierung: Wohnraumlüftung einfach nachrüsten (baupraxis.de)

Image by 849356 from Pixabay
Gute Luft im Auto – VDI Richtlinie
Die Fahrt zum nächsten Supermarkt, zur Arbeit oder ins Fitnessstudio im Nachbarort – wir verbringen in unserem Alltag viel Zeit in Fahrzeugen. Vor allem für Allergiker können selbst die kürzesten Strecken, gerade jetzt zur beginnenden Pollensaison, zur Herausforderung werden, wenn die lästigen Allergene durch offene Fenster in den Fahrzeuginnenraum gelangen und Niesattacken oder Hustenanfälle auslösen. Aber auch für Nicht-Allergiker ist eine gute Lufthygiene essenziell. Gerade bei längeren Fahrten, beispielsweise in den Urlaub, gilt es, einige Tipps zur Optimierung der Innenraumluft zu beachten, denn Schadstoffe des Straßenverkehrs wie Feinstoff oder Stickstoffdioxid machen auch an der Autotüre nicht Halt. Müdigkeit und Konzentrationsverlust sind die Folge.
Für angenehme Temperaturen während der Fahrt, verfügen mittlerweile fast alle Fahrzeuge über eine Klimaanlage. Im Sommer hilft sie gegen Hitze und im Winter sorgt sie für warme Temperaturen. Außerdem hilft sie gegen beschlagene Scheiben und somit für eine ausreichende Sicht. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für die Luftqualität im Fahrzeug entscheidend, so der VDI in seinem Beitrag „Lufthygiene in Fahrzeuginnenräumen“.
Die in einem überarbeiteten Entwurf erschienene Richtlinie VDI/ZDK 6032 Blatt 2 „Lufttechnik; Luftqualität in Fahrzeugen; Hygieneanforderungen an die Lüftungstechnik; Pkw/Lkw“ beschreibt und bewertet dabei nicht nur den gewünschten Ist-Zustand der Luft im Fahrzeug, sondern versucht den längst überfälligen Standard zu etablieren, damit gesunde Luft im Auto nicht mehr nur ein Zufallsprodukt ist, sondern zur Konstante wird.
Risikofaktor Klimaanlage: Wartung und Filterwechsel den Experten überlassen
Die Klimaanlage – bei all ihren Vorteilen – kann jedoch schnell zum Risikofaktor für die Gesundheit werden. Durch den Kühlvorgang sammelt sich Kondenswasser am Lamellensystem des Verdampfers und bietet Bakterien und Schimmelpilzen sowie Pollen und Staub die idealen Voraussetzungen zur Ansiedelung. Beim Einschalten der Klimaanlage wird durch die Luftzufuhr in das Fahrzeug relativ schnell eine hohe Schadstoffkonzentration durch organische, mikrobiologische, allergene und chemische Verunreinigungen in der Atemluft erreicht.
Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, regelmäßig den Filter der Anlage zu wechseln und eine Reinigung der entsprechenden Teile der Klima- und Lüftungsanlage durchzuführen. In einigen Werkstätten gibt es mittlerweile zwar den „Klimaservice“, allerdings bedeutet dieser nicht unbedingt die Reinigung der Anlage, sondern vielmehr die Prüfung ihrer Funktionsfähigkeit. Auch der Austausch des Filters bedeutet nicht gleich Reinigung. Es erfordert bei der Reinigung eine sachkundige Verfahrensweise und Wissen über die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
In dem Bericht des VDI heißt es deshalb: „Ziel der Richtlinie ist es daher, Fahrzeugherstellern, Konstruktionsverantwortlichen, Zulieferern, Fuhrparkverantwortlichen, Arbeitgebern und Kfz-Werkstätten wichtige technische Empfehlungen zu geben, um mit dem Stand der Technik Innenraumlufthygiene- oder ganz einfach gesunde Luft im Pkw und Lkw – nachhaltig sicherzustellen und damit Mobilität und Verkehr diesbezüglich risikoärmer, attraktiver und vor allem zeitgemäß zu gestalten.“
Den ganzen Artikel des VDI können Sie hier nachlesen.

Foto von averie woodard auf https://unsplash.com
Aerosole und Raumluft: Säuren helfen gegen Viren
Mehrere Schweizer Hochschulen veröffentlichen eine gemeinsame Studie, die zeigt, dass Aerosole unterschiedlich sauer sein können und ihr Säuregehalt bestimmt, wie lange sie infektiös bleiben.
Ob Corona- oder Grippeviren – sie reisen quasi per Anhalter von Mensch zu Mensch: über Aerosole. Diese feinen, in der Luft schwebenden flüssigen Teilchen werden beim Husten, Niesen und Sprechen über die Atmung an die Luft abgegeben und von anderen Menschen wieder eingeatmet.
Dass der Säuregehalt dieser kleinen Teilchen bei der Infektiösität eine Rolle spielt, konnten Forscher nun belegen. Sie untersuchten die chemische Zusammensetzung und insbesondere den Säuregehalt der ausgeatmeten Aerosolpartikel in Wechselwirkung mit der Raumluft. Was die Forscher schon wussten, ist, dass zum Beispiel Influenza-Viren sehr säureempfindlich sind. Was das aber genau über die geladene Virenfracht auf dem Aerosol-Transporter aussagt, wurde nun erforscht. In einer neuen Studie zeigen sie erstmals auf, wie sich der pH-Wert der Aerosolpartikel in der Zeit nach dem Ausatmen während Sekunden bis Stunden unter verschiedenen Umgebungsbedingungen verhält. Weiter zeigen sie, wie sich dies auf die in ihnen enthaltenen Viren auswirkt.
Fazit: Den Forscher*innen zufolge versauern die Aerosolteilchen schneller als gedacht. Dafür ist Salpetersäure verantwortlich, die über die Außenluft beim Lüften in den Innenraum gelangt. Sie entsteht beim Abbau von Stickoxiden. Die Aerosole nehmen die Salpetersäure auf, machen sie sauer und verringern damit ihren pH-Wert. Influenza-Viren mögen das gar nicht und werden bei einem pH-Wert unter 4 inaktiv. SARS-CoV-2 Viren hingegen sind säureresistenter und werden erst bei einem pH-Wert unter 2 inaktiviert.
Die Studie zeigt also, dass in gut gelüfteten Räumen die Inaktivierung von Influenza A-Viren in Aerosolen effizient funktioniert, und auch die Bedrohung durch SARS-CoV-2 reduziert werden kann. In schlecht gelüfteten Räumen hingegen ist das Risiko aktiver Viren in Aerosolen verglichen mit Räumen mit starker Frischluftzufuhr 100-Mal höher.
Die Zusammenfassung der Studie finden Sie hier: Säuren helfen gegen Viren in der Luft | ETH Zürich

Image by Donate PayPal Me from Pixabay
Luftqualität im Innenraum: Ikea bringt smartes Messgerät auf den Markt
„Vindstyrka“ heißt das smarte Messgerät aus dem schwedischen Möbelhaus IKEA, das neben der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Feinstaubbelastung in Innenräumen anzeigt.
Über eine Farbskala im Display (rot, orange, grün) lässt sich erkennen, wie gut die Luftqualität ist.
Das Gerät unterstützt den neuen Smarthome-Standard Matter und lässt sich mit dem Ikea-Smarthub „Dirigera“ verbinden. Dank des Matter-Supports ist ebenso eine Verbindung mit Apple Home und Android möglich, sodass die Nutzer hier freie Wahl haben.
Außerdem kann Vindstyrka den smarten Luftreiniger Starkvind, ebenfalls von IKEA, steuern. Ist die Luftqualität schlecht, weil etwa der Feinstaubgehalt in der Wohnung einen bestimmten Wert überschreitet, kann die Drehzahl des Starkvind-Lüfters automatisch gesteigert werden.
Der Vindstyrka ist voraussichtlich ab April zu einem Preis von unter 40 Euro erhältlich.
Mehr Informationen gibt es hier:
Vindstyrka: Ikea bringt smarten Luftqualitätssensor für 40 Euro (t3n.de)
IKEA launches VINDSTYRKA – a smart sensor to measure indoor air quality

Die 5×5-Regel für richtiges Lüften im Winter
Für ein gesundes Raumklima und um Schimmel zu umgehen, ist Richtiges Lüften wichtig. Das ist nunmehr bekannt. Aber wie lüftet man bei den derzeitigen Temperaturen richtig? Im Moment herrscht in Deutschland Eiszeit. Öffnet man auch nur kurz das Fenster ist es meist, nach einigen Sekunden schon eisig kalt.
Der Verband Fenster + Fassade rät zu folgender Faustregel für das Lüften per Hand im Winter:
- Unter 0 Grad: Beträgt die Außentemperatur unter 0 Grad Celsius sollten die Fenster nur für 5 Minuten geöffnet werden.
- Bei 0 bis 10 Grad: In diesem Temperaturbereich sind rund 10 Minuten lüften ausreichend.
- Mehr als 10 Grad: Bei mehr als 10 Grad können die Fenster für rund 15 Minuten zum Lüften geöffnet werden.
Bekannt ist bereits, dass regelmäßiges Stoßlüften statt Kippen des Fensters, egal bei welchen Temperaturen, die bessere Lösung ist. Im Frühjahr und Herbst eignet es sich sogar für bis zu 20 Minuten, die Fenster bis zu fünf Mal am Tag zu öffnen. Diese Zeit ist im Winter aber natürlich nicht möglich. Da es aber genauso empfehlenswert ist, im Winter ebenso oft zu lüften, als auch zu den anderen Jahreszeiten, empfiehlt es sich die 5×5-Regel anzuwenden: Also fünf Mal pro Tag für fünf Minuten lüften.
Falls Sie das nicht einhalten können, weil sie tagsüber nicht zuhause sind, braucht es eine andere Lösung. Die 3×5-Regel, also drei Mal pro Tag für fünf Minuten zu lüften, reicht hier aus. Am besten lüften Sie am Morgen nach dem Aufstehen, wenn Sie nach Hause kommen und nochmal kurz vor dem Schlafengehen.
Um an das Lüften zu denken, ohne sich immer einen Timer stellen zu müssen, empfehlen die Experten vom Fachverband: „Man sollte lüften, wenn es nötig ist und auch nur so lange wie nötig. Helfen kann hier neben dem persönlichen Empfinden ein Hygrometer. Ab einer Luftfeuchte von mehr als 60 Prozent muss gelüftet werden“.
Zu finden gibt es die Thermo-Hygrometer sowohl in analoger und digitaler Form. Schon für kleines Geld sind sie im Baumarkt zu finden. Alternativ gibt es auch Smart-Home-Lösungen online zu finden, mit denen Sie die Luftfeuchtigkeit um Auge behalten können.
Den passenden Artikel der Chip-Redaktion finden sie hier.
Illustration: Andrey Popov @ AdobeStock . com