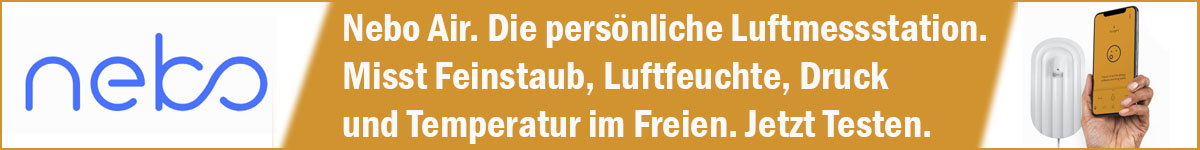Aktuelle Nachrichten zu Lufthygiene, Corona und COVID-19 aus Forschung und Wissenschaft.
Komplexer als gedacht: Neue Erkenntnisse zum Aufbau von Aerosolen
 Aerosole haben es in der Corona-Pandemie zu einer zweifelhaften Berühmtheit gebracht. Gelten diese kleinsten Schwebeteilchen doch weithin als unsichtbarer Hauptübertragungsweg des Corona-Virus. Über ihren genauen Aufbau ist bis dato allerdings noch nicht allzu viel bekannt.
Aerosole haben es in der Corona-Pandemie zu einer zweifelhaften Berühmtheit gebracht. Gelten diese kleinsten Schwebeteilchen doch weithin als unsichtbarer Hauptübertragungsweg des Corona-Virus. Über ihren genauen Aufbau ist bis dato allerdings noch nicht allzu viel bekannt.
Ein Team aus US-amerikanischen und kanadischen Forschern hat nun herausgefunden, dass Aerosole weit komplexer aufgebaut sind, als bisher gedacht. Sie können nicht nur – wie bisher angenommen – aus zwei flüssigen Anteilen bestehen, sondern sogar drei verschiedene flüssige Phasen enthalten, die sich automatisch voneinander trennen.
Auf Basis dieser neuen Erkenntnisse sollen sich künftig auch z.B. genauere Wetterprognosen und bessere Modelle über Luftverschmutzung und Klimavorhersagen erstellen lassen.
Zum vollständigen Beitrag geht es hier entlang: https://science.ubc.ca/news/discovery-new-liquid-phases-aerosol-particles-could-better-explain-how-air-pollutants-interact
Forscher weisen DNA in Raumluft nach
 Ob beim Virennachweis mittels PCR-Test, in der Kriminalistik oder bei der Suche nach seltenen Tieren: DNA-Proben gehören heute in vielen Fachgebieten zum Alltag. Das für die Analysen nötige Erbgut wird dafür meist aus Blut- oder Speichelproben isoliert, aber auch Haare, Bodenproben oder Wasser können auf DNA-Fragmente hin untersucht werden.
Ob beim Virennachweis mittels PCR-Test, in der Kriminalistik oder bei der Suche nach seltenen Tieren: DNA-Proben gehören heute in vielen Fachgebieten zum Alltag. Das für die Analysen nötige Erbgut wird dafür meist aus Blut- oder Speichelproben isoliert, aber auch Haare, Bodenproben oder Wasser können auf DNA-Fragmente hin untersucht werden.
Was bislang nicht berücksichtigt wurde: Über den Atem, Hautschüppchen, Sekrete oder Ausdünstungen geben Menschen und Tiere ständig Erbgutspuren an die Umgebungsluft ab, die eine Art „persönliche Wolke“ bilden.
Ob diese genetischen Spuren in Raumluftproben nachweisbar sind, haben Elizabeth Clare und ihr Team von der Queen Mary University of London untersucht. Dafür saugten sie über spezielle HEPA-Filter Luft aus einem Versuchsraum, in dem seit mehr als einem Jahr Nacktmulle leben und der regelmäßig von Tierpflegern und Wissenschaftlern betreten wird. Das Ergebnis: Obwohl die Proben buchstäblich aus der Luft gegriffen waren, enthielten sie nachweisbare Mengen an tierischer und menschlicher DNA.
Hilfreich ist diese Erkenntnis für verschiedenste Bereiche. So könnte in der Kriminalistik die DNA des Täters selbst dann noch aufspürt werden, wenn Blut oder Haare am Tatort fehlen. In der Ökologie könnte die Luft-DNA dazu dienen, seltene und scheue Tiere anhand ihrer Höhlen, Nester oder Baue aufzuspüren und zu identifizieren. Auch im Zusammenhang mit Pandemien und anderen infektiösen Krankheiten könnten Luftproben hilfreich sein: Über sie ließe sich beispielsweise feststellen, ob und wie weit ein Erreger über die Luft übertragen wird. „Im Moment beruhen die Social-Distancing-Richtlinien vor allem auf physikalischen Messungen, wie weit sich Tröpfchen und Virenpartikel verteilen“, so die Forschenden. Mit ihrer Technik könnte hingegen die Luft selbst beprobt und direkt ermittelt werden, welche Erreger in der Luft vorhanden sind.
Wirksames Corona-Mittel ohne Rechtmäßigkeit?
 Im Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus hat ein Lübecker Professor bereits vor geraumer Zeit einen Impfstoff entwickelt, der dem Vernehmen nach nicht nur äußerst wirkungsvoll ist gegen Covid-19, sondern sich auch schnell gegen mögliche Mutationen anpassen lässt und zudem noch einfach in der Logistik bzw. Handhabung ist. Eigentlich eine glänzend gute Nachricht, wären da nicht anhängende Rechtsstreitigkeiten wegen fehlender Studien und Unterstellungen. In einem Videobeitrag berichtet beispielsweise Spiegel TV über die Entwicklung und den Status quo in der Causa „Lübecker Anti-Corona-Impfstoff ohne Zulassung“. Zum Videobeitrag geht es > hier entlang <.
Im Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus hat ein Lübecker Professor bereits vor geraumer Zeit einen Impfstoff entwickelt, der dem Vernehmen nach nicht nur äußerst wirkungsvoll ist gegen Covid-19, sondern sich auch schnell gegen mögliche Mutationen anpassen lässt und zudem noch einfach in der Logistik bzw. Handhabung ist. Eigentlich eine glänzend gute Nachricht, wären da nicht anhängende Rechtsstreitigkeiten wegen fehlender Studien und Unterstellungen. In einem Videobeitrag berichtet beispielsweise Spiegel TV über die Entwicklung und den Status quo in der Causa „Lübecker Anti-Corona-Impfstoff ohne Zulassung“. Zum Videobeitrag geht es > hier entlang <.
Aerosolforscher fordern Kurswechsel bei Anti-Corona-Maßnahmen
 „Die Übertragung der SARS-CoV-2 Viren findet fast ausnahmslos in Innenräumen statt“ – darauf weisen die führenden Köpfe der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) in einem offenen Brief an die Bundesregierung hin, verbunden mit einem Aufruf, ihren Umgang mit der Corona-Pandemie teilweise zu überdenken. Im Freien werde das Virus nur „äußerst selten“ übertragen und führe nie zu breitgefächerten Ansteckungen (Clusterinfektionen).
„Die Übertragung der SARS-CoV-2 Viren findet fast ausnahmslos in Innenräumen statt“ – darauf weisen die führenden Köpfe der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) in einem offenen Brief an die Bundesregierung hin, verbunden mit einem Aufruf, ihren Umgang mit der Corona-Pandemie teilweise zu überdenken. Im Freien werde das Virus nur „äußerst selten“ übertragen und führe nie zu breitgefächerten Ansteckungen (Clusterinfektionen).
Doch genau diese Sensibilisierung findet aus Sicht der Forscher nicht ausreichend statt. Die öffentliche Debatte über Corona-Maßnahmen bilde nicht den wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab, sodass viele Menschen „falsche Vorstellungen über das mit dem Virus verbundene Ansteckungspotential“ hätten. Durch Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren entstehe der Eindruck, dass es draußen gefährlich sei. Die tatsächliche Gefahr lauere aber bei „heimlichen Treffen in Innenräumen“. Auch, weil eine Ansteckungsgefahr nicht nur durch den direkten Kontakt mit einem Infizierten besteht, sondern auch dann, wenn sich dieser zuvor im Raum aufgehalten hat.
Auch auf die Notwendigkeit von Schutzmasken in Innenräumen weisen die Forscher explizit hin: „In der Fußgängerzone eine Maske zu tragen, um anschließend im eigenen Wohnzimmer eine Kaffeetafel ohne Maske zu veranstalten, ist nicht das, was wir als Experten unter Infektionsvermeidung verstehen.“ Zudem seien Raumluftreiniger und Filter überall dort zu installieren, wo Menschen sich länger in geschlossenen Räumen aufhalten müssen (Wohnheime, Schulen, Alten- und Pflegeheime, Betreuungseinrichtungen, Büros und andere Arbeitsplätze). Auch Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und Gottesdienste sollen in große, gut gelüftete Hallen verlegt werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.
Vorbildlich: Gesundheitsamt Lübeck informiert über Raumlufttechnische Anlagen
 Nicht in jedem Raum oder Gebäude lassen sich zur Luftdurchfrischung Fenster und/oder Türen öffnen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, über die Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) nachzudenken.
Nicht in jedem Raum oder Gebäude lassen sich zur Luftdurchfrischung Fenster und/oder Türen öffnen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, über die Installation von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) nachzudenken.
Eine Hilfestellung zur anfänglichen Planung gibt das Gesundheitsamt Lübeck seinen Bürgern und Bürgerinnen an die Hand: Unter diesem Link finden sich Hinweise, Erläuterungen und Einschätzungen rund um das Thema Lufthygiene unter Pandemie-Bedingungen.
US-Forscher empfehlen Abkehr von bisheriger Impfstrategie
 Eine aktuelle Studie aus den USA empfiehlt, die Erstimpfung aller einer Komplettimmunisierung mit zwei Impfdosen einzelner Risikogruppen vorzuziehen. Nach Gabe der ersten Dosis habe der Geimpfte bereits einen weitreichenden Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Zudem sei das von der STIKO und Co. befürchtete Szenario, dass sich impfresistente Virus-Mutationen durch sogenannte Teilgeimpfte bilden, niedriger als bisher angenommen. Wenn viele Menschen bereits eine erste Impfung erhalten haben, werden – so die Forscher – viele Infektionen und auch das Auftreten sogenannter Superspreader vermieden. Dies verringert wiederum das Risiko, dass sich Mutationen bilden.
Eine aktuelle Studie aus den USA empfiehlt, die Erstimpfung aller einer Komplettimmunisierung mit zwei Impfdosen einzelner Risikogruppen vorzuziehen. Nach Gabe der ersten Dosis habe der Geimpfte bereits einen weitreichenden Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Zudem sei das von der STIKO und Co. befürchtete Szenario, dass sich impfresistente Virus-Mutationen durch sogenannte Teilgeimpfte bilden, niedriger als bisher angenommen. Wenn viele Menschen bereits eine erste Impfung erhalten haben, werden – so die Forscher – viele Infektionen und auch das Auftreten sogenannter Superspreader vermieden. Dies verringert wiederum das Risiko, dass sich Mutationen bilden.
Daher empfehlen die Forscher, auf eine möglichst durchgängige Erstimmunisierung der breiten Bevölkerung zu setzten und die Gabe der Zweitdosen möglichst weit hinauszuzögern. Bei mRNA-Impfstoffen, wie z.B. Biontech/Pfizer und Moderna, würde das ein Ausreizen des Zeitraums für die Zweitimpfung auf zwölf Wochen bedeuten. Es könnten dann laut Forschern mehr Menschen mit einer ersten Dosis geimpft werden und so mehr Leben gerettet, schwere Krankheitsverläufe verhindert und Mutationen reduziert werden.
Alle weiteren Studienergebnisse sind nachzulesen unter https://www.nature.com/articles/s41577-021-00544-9#author-information.
ÖPNV trotz Corona sicher
 Eine aktuelle Studie, die die TU Berlin gemeinsam mit der Berliner Charité veröffentlicht hat, legt nahe, dass Busse und Bahnen auch in Pandemie-Zeiten sichere Verkehrsmittel sind – sowohl für die Passagiere als auch für die Fahrer.
Eine aktuelle Studie, die die TU Berlin gemeinsam mit der Berliner Charité veröffentlicht hat, legt nahe, dass Busse und Bahnen auch in Pandemie-Zeiten sichere Verkehrsmittel sind – sowohl für die Passagiere als auch für die Fahrer.
Für die Studie, die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) in Auftrag gegeben wurde, haben die Forscher experimentell untersucht, wie sich Aerosole in verschiedenen Berliner U-Bahnen, Tram-Bahnen und Bussen ausbreiten. Das Ergebnis ist klar und deutlich: Die Kombination aus den Lüftungsanlagen in den Fahrzeugen und das gezielte Öffnen von Fenstern und Türen kann die Aerosolkonzentration um bis zu 80 Prozent verringern und erhöht so die Sicherheit für Fahrer und Gäste. Und die positiven Auswirkungen, die das Tragen von Masken in den Fahrzeugen hat, ist bei diesem Experiment sogar noch gar nicht berücksichtigt.
Die vollständigen Studienergebnisse sind unter https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/pressemitteilungen-nachrichten/2021/maerz/aerosol-test-gute-luft-in-bus-und-bahn/ abrufbar.
mRNA-Impfstoffe schützen doppelt
 Gute Nachrichten aus den USA: mRNA-Impfstoffe, wie z.B. das Vakzin von Biontech/Pfizer, schützen nicht nur zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion. Sie senken – so das Ergebnis der aktuellen Studien aus den USA – sogar das Infektionsrisiko. Nach Erhalt der zweiten Impfdosis soll das Ansteckungsrisiko sogar nach Angaben der US-Amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC um 90 Prozent sinken. Das bedeutet: Wenn jemand beide Impfungen erhalten hat, kann das Virus höchstwahrscheinlich nicht mehr weitergegeben werden, was ein großer Schritt in der Pandemie-Bekämpfung wäre, da so unentdeckte Infektionen verhindert würden und Infektionsketten erfolgreich unterbrochen werden könnten.
Gute Nachrichten aus den USA: mRNA-Impfstoffe, wie z.B. das Vakzin von Biontech/Pfizer, schützen nicht nur zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion. Sie senken – so das Ergebnis der aktuellen Studien aus den USA – sogar das Infektionsrisiko. Nach Erhalt der zweiten Impfdosis soll das Ansteckungsrisiko sogar nach Angaben der US-Amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC um 90 Prozent sinken. Das bedeutet: Wenn jemand beide Impfungen erhalten hat, kann das Virus höchstwahrscheinlich nicht mehr weitergegeben werden, was ein großer Schritt in der Pandemie-Bekämpfung wäre, da so unentdeckte Infektionen verhindert würden und Infektionsketten erfolgreich unterbrochen werden könnten.
Via Tagesschau: tagesschau.de/ausland/amerika/mrna-impfstoffe-infektionsrisiko-101.html
Infektionstreiber Nummer 1: Privattreffen in geschlossenen Räumen

Wo stecken sich die meisten Menschen mit Corona an? Dieser für die Kontaktnachverfolgung und für daher für die Pandemie-Bekämpfung so elementaren Frage versucht ein Team von Forschern der TU Berlin auf den Grund zu gehen. Die Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. Kai Nagel haben dabei ein Modell entwickelt, das das Infektionsgeschehen anhand einzelner Lebensbereiche analysiert.
Die Forschungsergebnisse sprechen für sich: Treffen im privaten Raum sind rund 100 Mal gefährlicher als ein Einkauf im Supermarkt. Bereiche, in denen der ungeschützte Kontakt in geschlossenen Räumen weiterhin möglich ist, tragen – so die Wissenschaftler – dramatisch zum Infektionsgeschehen bei. Kontakte im Freien bzw. in geschlossenen Räumen unter Einhaltung der Hygiene-Regeln spielen hingegen kaum eine Rolle.
Besuche von Freunden, Bekannten und Verwandten in geschlossenen Räumen sind für die Forscher daher die Infektionstreiber Nummer 1. Denn Besuche und damit direkte Kontakte dauern im privaten Umfeld meist relativ lange an, und es wird viel miteinander geredet, was die Aerosolausbreitung im geschlossen Raum und somit die Infektionswahrscheinlichkeit erhöht. Das Virus hat zudem leichtes Spiel, da bei diesen Treffen oft auf das Tragen von Masken verzichtet wird und vorab meist keine Schelltests durchgeführt wurden. Als weitere Infektionstreiber identifizieren die Forscher zudem die sogenannten „unvermeidbaren Kontakte im eigenen Haushalt“, die Schule und der Arbeitsplatz.
Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: https://www.tu.berlin/nachrichtendetails/private-besuche-treiben-das-infektionsgeschehen/
AstraZeneca heisst jetzt „Vaxzevria“
 Der Impfstoff wurde aber nicht „heimlich umbenannt“, wie zahlreiche Medien eifrig behaupten. Vielmehr war „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ oder kurz „AstraZeneca“ nur der vorübergehende Produktname für das Zulassungsverfahren, abgeleitet aus den Namen der beiden Herstellerfirmen Astra und Zeneca. Der Impfstoff selbst war unter dem Namen „AZD122“ entwickelt worden. Dass der Impfstoff nach der Zulassung für die endgültige Vermarktung einen Handelsnamen erhält ist alles andere als ungewöhnlich. Nun heisst er eben „Vaxzevria“. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer heisst übrigens „Comirnaty“. Der Name ist aber auch sehr heimlich …
Der Impfstoff wurde aber nicht „heimlich umbenannt“, wie zahlreiche Medien eifrig behaupten. Vielmehr war „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ oder kurz „AstraZeneca“ nur der vorübergehende Produktname für das Zulassungsverfahren, abgeleitet aus den Namen der beiden Herstellerfirmen Astra und Zeneca. Der Impfstoff selbst war unter dem Namen „AZD122“ entwickelt worden. Dass der Impfstoff nach der Zulassung für die endgültige Vermarktung einen Handelsnamen erhält ist alles andere als ungewöhnlich. Nun heisst er eben „Vaxzevria“. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer heisst übrigens „Comirnaty“. Der Name ist aber auch sehr heimlich …
(Foto: Feydzhet Shabanov @ stock.adobe.com)
Illustration: Andrey Popov @ AdobeStock . com